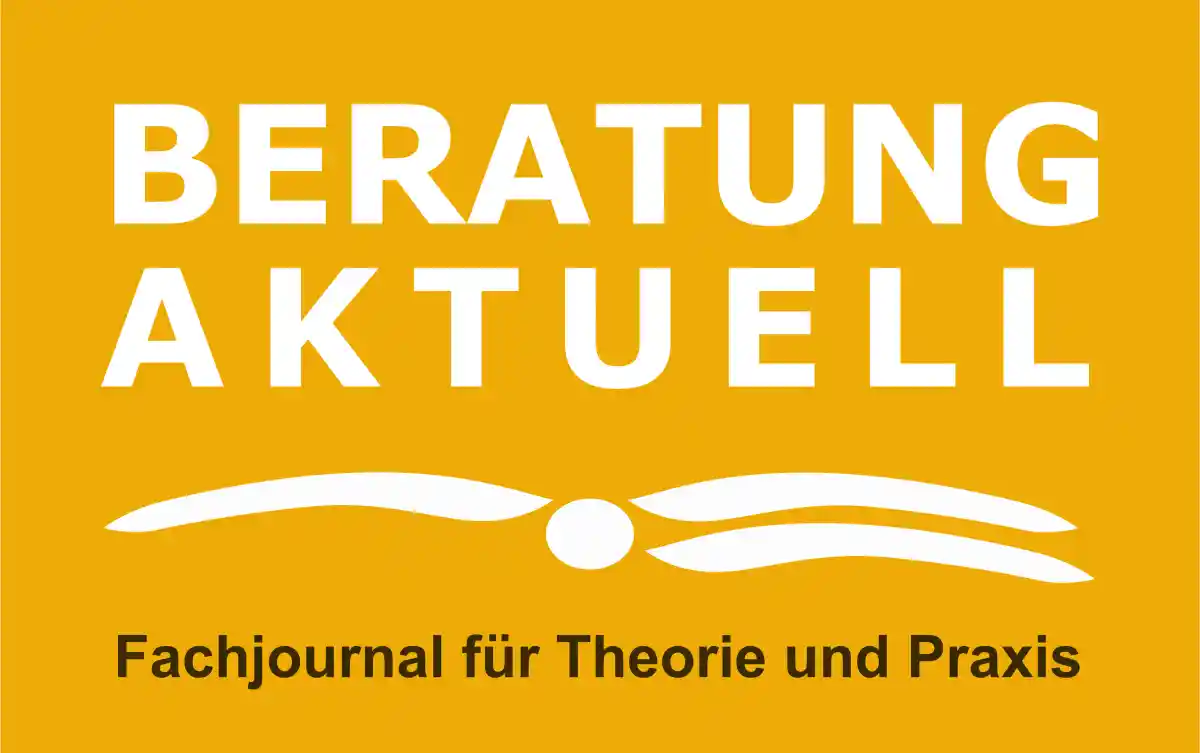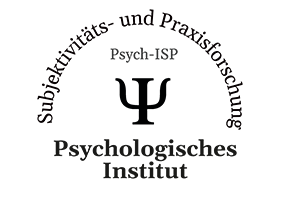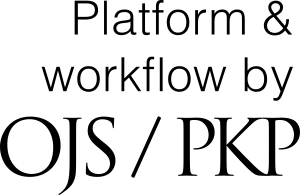Call for Papers 2/2026
Call for Papers: Themenheft:
Dilemmata und Paradoxien in der Sexuellen Bildung: Interdisziplinäre Perspektiven
Der Begriff Sexuelle Bildung beschreibt einen lebenslangen Entwicklungsprozess, in dem sich Menschen Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen zu sexualitätsbezogenen Themen aneignen. Ein Teil davon geschieht bewusst – etwa durch Unterricht und (Sexual-)Pädagogik, Beratung oder andere professionelle Angebote, die Reflexion und Handlungskompetenzen fördern und begleiten. Gleichzeitig findet Sexuelle Bildung auch implizit (also quasi unbewusst) statt, beeinflusst durch gesellschaftliche Diskurse, mediale Einflüsse und persönliche Erfahrungen. Die Diskurse rund um die Sexuelle Bildung stehen unter starkem normativem Druck und befinden sich im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen und Haltungen, die häufig polarisiert sind. Nicht selten geht es dabei weniger um die gemeinsame Suche nach Lösungen, als vielmehr darum, die eigene Sichtweise zu behaupten oder zu legitimieren. Auch zwischen den Disziplinen zeigen sich Differenzen: Sexualmedizin, Sexualwissenschaft, Sexualpädagogik, psychosoziale Beratung, Psychotherapie, Psychiatrie und Sozialarbeit blicken aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema, jeweils mit eigenen Begriffen, Annahmen und Kontexten sowie daraus resultierenden Strategien.
Dieses Themenheft setzt genau an diesen Schnittstellen an. Es positioniert sich pluralistisch, interdisziplinär und paradigmenübergreifend und ermöglicht einen problemzentrierten, ergebnisoffenen und reflexiven Diskurs zwischen Fachgesellschaften, Disziplinen und Denkschulen, mit dem Ziel, voneinander zu lernen und sich gemeinsam den inhärenten Dilemmata und Paradoxien der Sexuellen Bildung zu stellen.
Beiträge könnten dabei kontext- und disziplinenbezogen oder inhaltlich-thematisch fokussiert sein. Neben eigenen Themenvorschlägen könnten folgende Fragen für Beiträge relevant sein:
- Welche Rolle spielt Sexuelle Bildung in unterschiedlichen Settings von Therapie über Beratung bis zur Pädagogik? Wie viel psychologisches und therapeutisches Handwerkszeug braucht die Sexualpädagogik – und umgekehrt? Wo kann Sexualpädagogik präventiv wirken, und wie wirken sich problem- oder defizitorientierte Perspektiven auf Sexualität und den Diskurs aus; oder anders formuliert: Wie lässt sich das Spannungsfeld zwischen vermeintlicher Verharmlosung einerseits und Störungsbetonung andererseits produktiv machen, ohne dass eine Seite die andere vereinnahmt?
- Wie verhandeln wir Paradoxien und Dilemmata, also Situationen, in denen widersprüchliche Werte gleichzeitig gelten, Entscheidungen eine Güterabwägung verlangen und Neutralität nur schwer zu wahren ist?
- Zwischen welchen Polen bewegt sich professionelle Haltung, z.B. zwischen Antiunterschiedshypothesen und Differenzmarkierung (z.B. in Bezug auf Geschlecht oder Gruppen) oder auch zwischen Liberalisierung, Normalisierung und Gefährdung? Ebenso zwischen Nähe und professioneller Distanz, zwischen Schutzauftrag und Anerkennung sexueller Selbstbestimmung, zwischen individueller Freiheit und institutioneller Verantwortung oder zwischen dem Anspruch auf Wertneutralität und der Notwendigkeit, Position zu beziehen?
- Wie kann kultursensibles oder auch diversitätssensibles Arbeiten gelingen, ohne zu relativieren oder zu essentialisieren?
- Wie lassen sich die Rechte von Kindern, die Erziehungsrechte von Eltern und die Pflichten von Institutionen miteinander in Einklang bringen? Was bedeutet beispielsweise Freiwilligkeit, wenn Sexualerziehung im schulischen Kontext verpflichtend ist?
- Was gilt heute als »richtiger« oder »falscher« Sex – und wie prägen gesellschaftliche Diskurse unser Verständnis davon? Leben wir in einer Zeit neuer Normen von Lust und Diversität, die ihrerseits neue Erwartungen und Zwänge schaffen, oder ist das Bild möglicher sexueller Ausdrucksformen noch immer enger als es scheint? Und wie navigiert man professionell, falls beides gilt?
Eingereicht werden können:
- Theoretische und empirische Beiträge (30.000 Zeichen)
- Theoretisch gerahmte Praxisberichte und Fallskizzen (25.000 Zeichen)
- Kommentare (20.000 Zeichen)
- Rezensionen (20.000 Zeichen)
Wenn Sie Interesse daran haben, einen Beitrag einzureichen, melden Sie sich gerne vorab mit einem kurzen Abstract bei der Redaktion. Die Abgabe des Fullpapers ist bis zum 15.07.2026 möglich. Die Ausgabe erscheint Ende 2026 (Heft 2/2026) im Psychosozial-Verlag. Bitte senden Sie Ihre Abstracts und dann Beiträge per E-Mail an: redaktion@beratung-aktuell.de
Bei inhaltlichen Rückfragen wenden Sie sich gerne an: johanna.degen@uni-flensburg.de
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und sind bei Rückfragen gerne erreichbar.
Themenheftbetreuung: Johanna L. Degen, Niklas Albers & Andreas Gloël (pro familia)
Herausgeberinnen der Beratung aktuell: Johanna L. Degen, Judith Lurweg, Monika Wacker